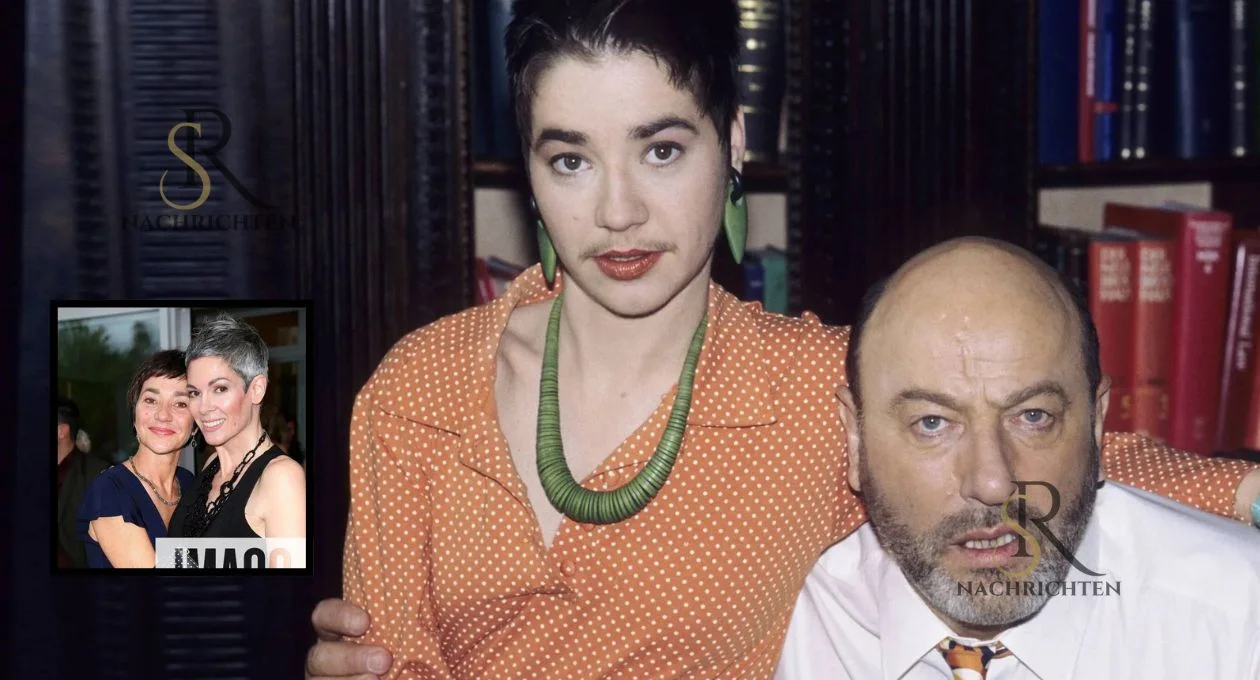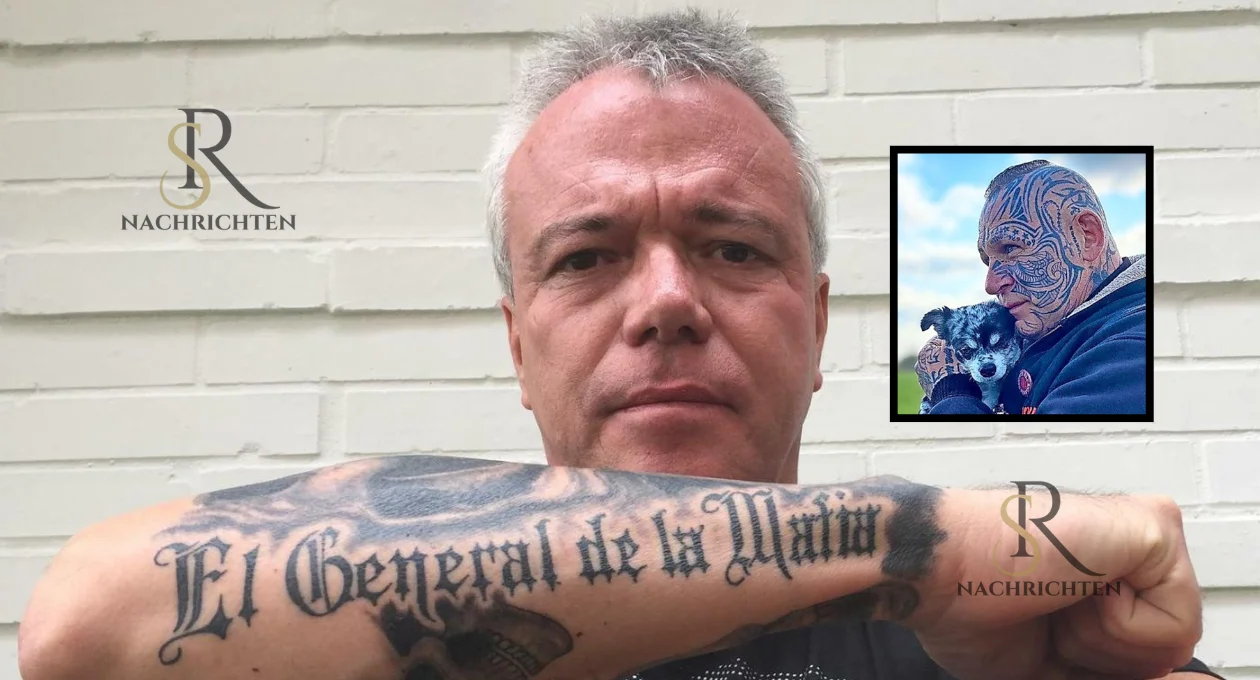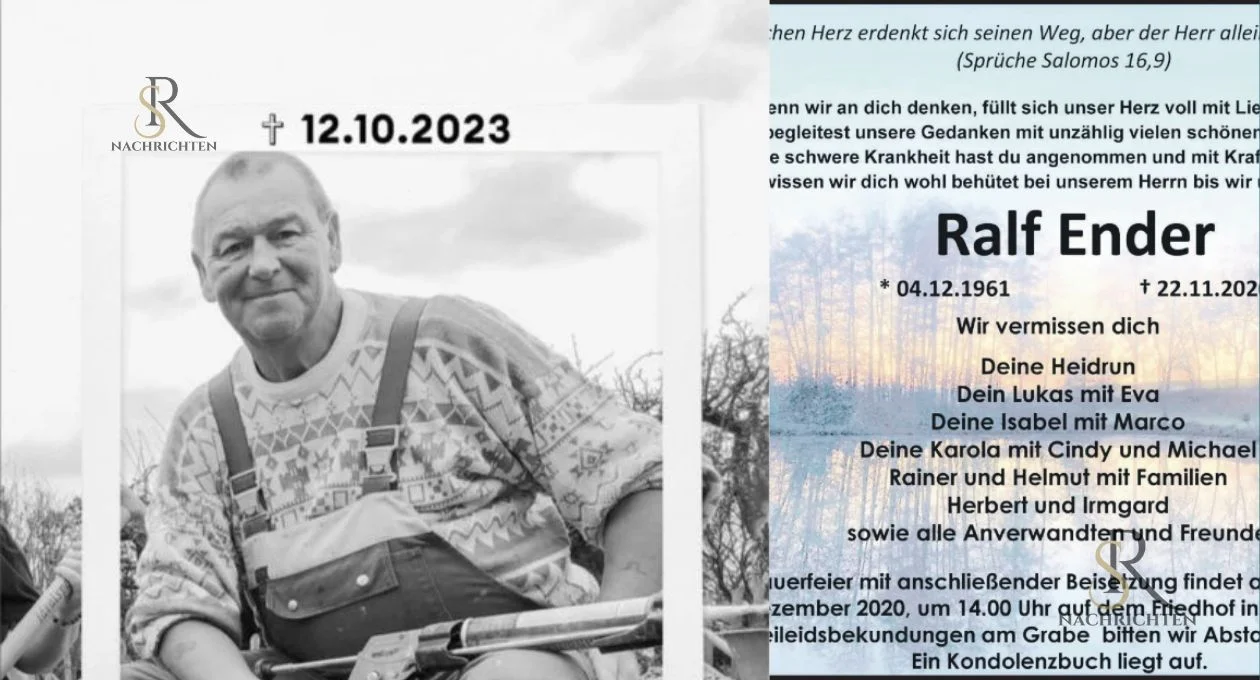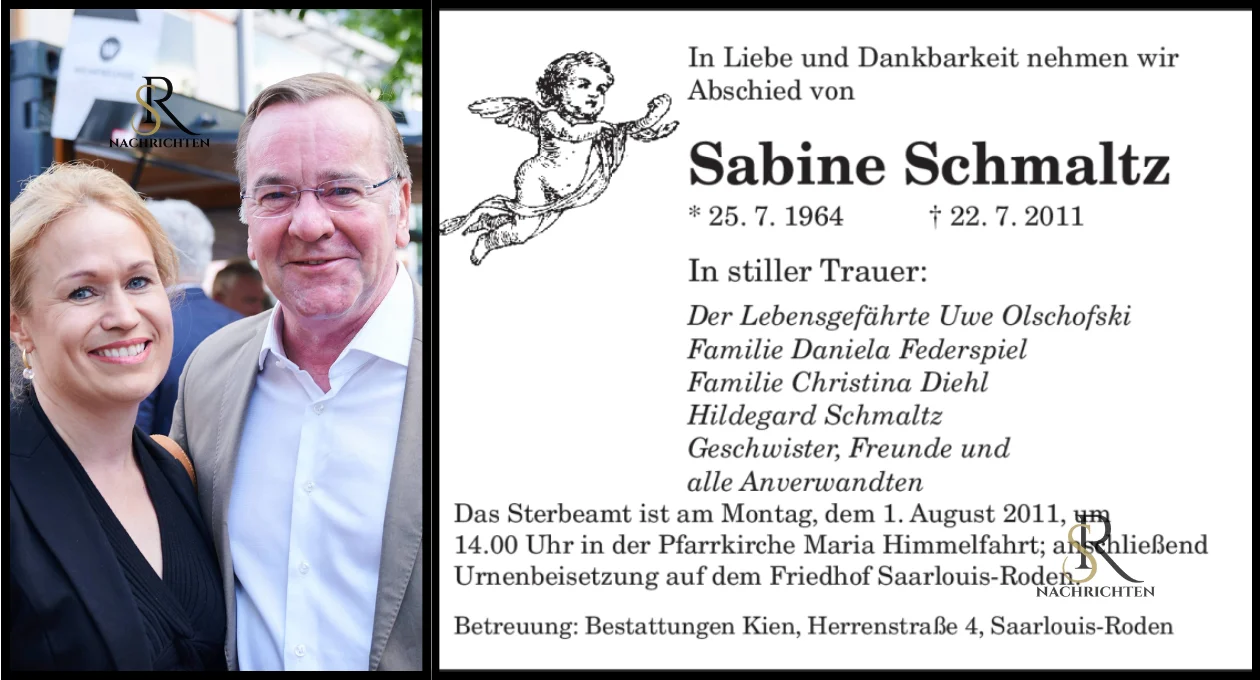Global spenden Millionen Verbraucher jedes Jahr auf diese Weise Kleinstbeträge für soziale Projekte, Tierschutz oder Katastrophenhilfe. Im Onlinehandel ist dieses Modell – der sogenannte Charity-Checkout – bisher weniger präsent, gewinnt aber 2025 auch in Deutschland deutlich an Bedeutung. Neue Studien, Plattformen und Payment-Integrationen zeigen, dass Kleinstspenden auch digital funktionieren können. Für Händler eröffnen sich dadurch Chancen, das Vertrauen der Kunden zu stärken und den eigenen Markenwert zu steigern – vorausgesetzt, Transparenz und einfache Abläufe stehen im Vordergrund.
Table of Contents
ToggleVon Supermärkten ins Netz
Während Aufrunden an der Kasse im stationären Handel längst etabliert ist, zieht der digitale Handel nach. Besonders in den USA hat sich das Modell bereits durchgesetzt: Laut dem „2025 Charity Checkout Champions Report“ sammelten 92 Handelsketten und Marken über 275 Millionen US-Dollar für gemeinnützige Zwecke. Auffällig ist dabei, dass 81 Prozent der erfolgreichen Kampagnen auf feste Spendenbeträge setzten, etwa 1 oder 2 Dollar, statt frei wählbarer Summen. Solche klaren Vorgaben senken die Entscheidungshürde für Verbraucher.
Das Prinzip ist aus anderen Bereichen bekannt: In der Gaming-Welt lassen sich Skins oder Zusatzinhalte oft schon für wenige Euro erwerben, während im Online-Glücksspiel manche Anbieter schon Einzahlungen von 5 € annehmen. Gerade die niedrigen Beträge sorgen dafür, dass Nutzer schneller zustimmen – die Hemmschwelle sinkt deutlich.
Zudem zeigte sich, dass ein Viertel der beteiligten Marken während der Spendenkampagnen sogar Umsatzzuwächse verzeichnete – ein Hinweis darauf, dass soziale Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch sein müssen. Ein europäisches Beispiel ist Pennies in Großbritannien: Bis 2020 über 100 Mio. Spenden mit rund 25 Mio. £; bis 2024 bereits über 230 Mio. Spenden mit mehr als 55 Mio. £. Hier spenden Kunden meist zwischen 1 und 99 Pence pro Transaktion.
Plattformen und Payment-Provider
Auch im klassischen E-Commerce wächst die Zahl der Anbieter, die Charity-Checkout ermöglichen. PayPal betreibt in Großbritannien das Programm „Give at Checkout“, bei dem Nutzer beim Bezahlen per Mausklick 1 Pfund an ihre bevorzugte Organisation spenden können. Analysen zeigen: Wer einmal eine Lieblingsorganisation auswählt, spendet viermal häufiger.
Auch Adyen integriert Spendenmöglichkeiten direkt in seine Payment-Lösungen. Mit dem Programm Adyen Giving können Händler Spendenoptionen online und stationär einbinden. Wichtig: 100 Prozent der Beträge fließen an die Organisationen, da Adyen die Transaktionsgebühren übernimmt. Damit sinkt die Gefahr, dass Kunden das Modell als „Marketing-Trick“ wahrnehmen.
Chancen und Grenzen
Aktuelle Forschung verdeutlicht, dass die Gestaltung des Spendenprozesses entscheidend ist. Eine Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass nonverbale, öffentlich sichtbare Spendenaufforderungen – etwa auf Bildschirmen oder in digitalen Checkouts – effektiver sind als mündliche Bitten. Letztere werden häufiger als aufdringlich empfunden und können die Spendenbereitschaft sogar verringern.
Noch deutlicher sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage von 2024: 53 % der Befragten gaben an, im letzten Jahr mindestens einmal an der Kasse oder im Online-Checkout gespendet zu haben. Damit zeigt sich, dass Charity-Checkout zwar von Kleinstbeträgen lebt, diese aber in der Summe zu einer relevanten Finanzierungsquelle für Organisationen werden. Für Händler bedeutet das: Transparenz über die Spendenempfänger ist Pflicht, sonst droht ein Vertrauensverlust.
Imagepflege oder echtes Engagement?
Für Händler stellt sich die Frage, ob Charity-Checkout ein reines Marketinginstrument oder ein ernst gemeintes Engagement ist. Laut Anbieter Change.io steigern Spendenoptionen im Checkout Conversion um 19 %, den Customer Lifetime Value um 23 % und den durchschnittlichen Warenkorbwert um 18 % – basierend auf internen Case Studies. So wird aus sozialem Engagement zugleich ein betriebswirtschaftliches Werkzeug.
Allerdings reagieren Konsumenten zunehmend sensibel auf Intransparenz. Wird nicht klar kommuniziert, welche Organisationen unterstützt werden und wie die Spenden abgewickelt werden, kippt der positive Effekt schnell ins Negative. Händler, die auf Charity-Checkout setzen, müssen daher auf klare Empfängerangaben und nachvollziehbare Prozesse achten – sonst wirkt der gute Zweck wie ein bloßer Marketingtrick.
Vom Nischenangebot zum Standard?
Im Jahr 2025 ist Charity-Checkout im Onlinehandel sichtbarer als noch vor wenigen Jahren, aber längst nicht so selbstverständlich wie im Supermarkt. Besonders in Deutschland steckt das Modell im Vergleich zu den USA oder Großbritannien noch in den Anfängen. Doch die Kombination aus wachsendem CSR-Bewusstsein, technischer Einfachheit durch Plug-ins und Payment-Integrationen und dem Wunsch vieler Konsumenten nach sozialem Impact im Alltag dürfte das Spenden im Warenkorb weiter vorantreiben.
Für Händler eröffnet sich die Chance, mit minimalem Aufwand Kundenbindung und Markenimage zu stärken. Entscheidend ist, dass das Modell freiwillig, transparent und nachvollziehbar bleibt. Dann können Kleinstbeträge im Checkout zu einem spürbaren Beitrag für die Gesellschaft werden – und gleichzeitig den wirtschaftlichen Erfolg unterstützen.