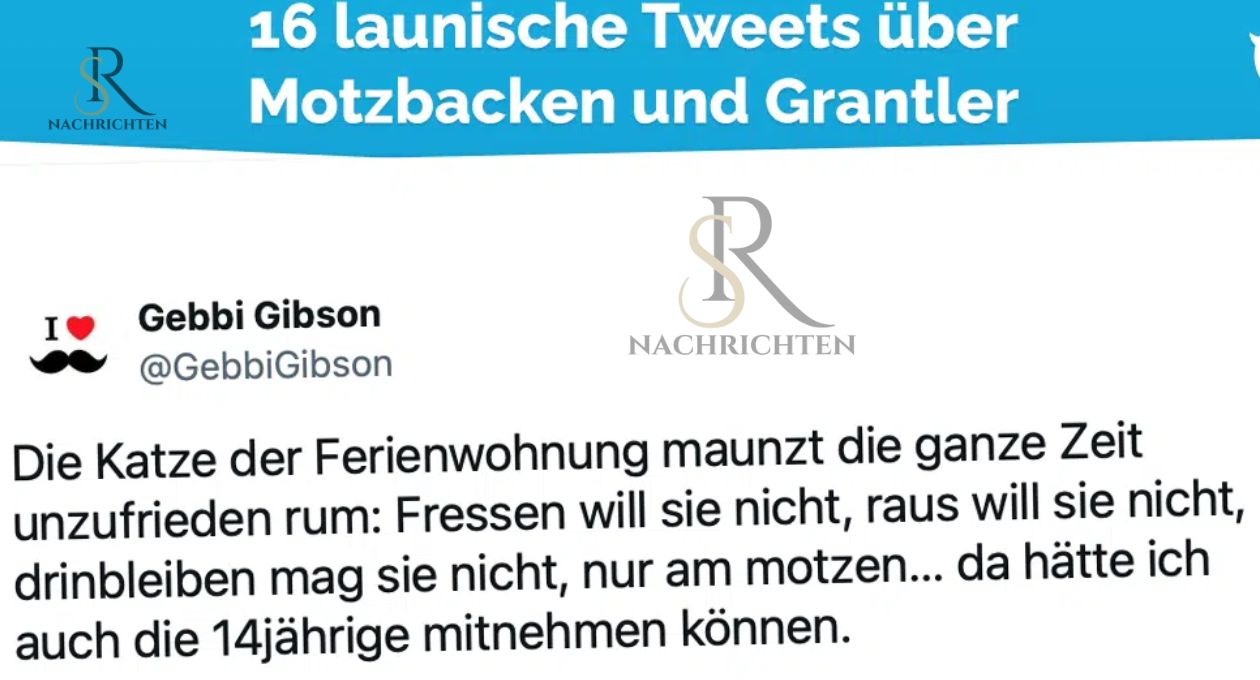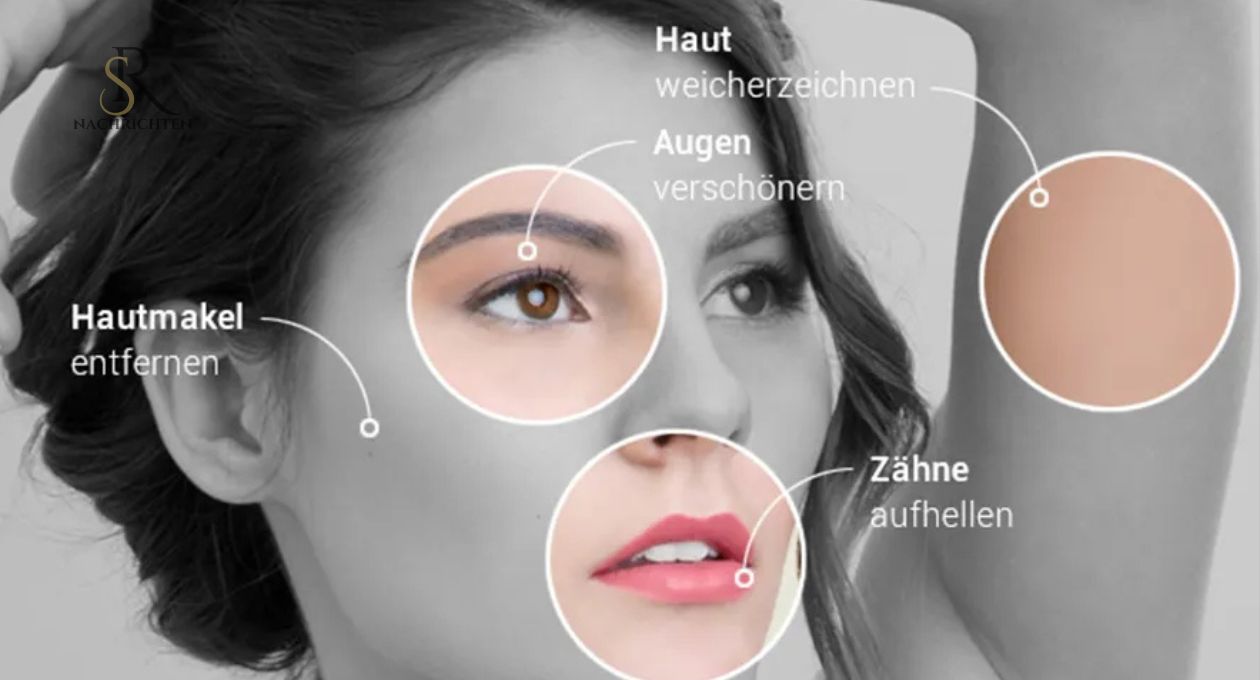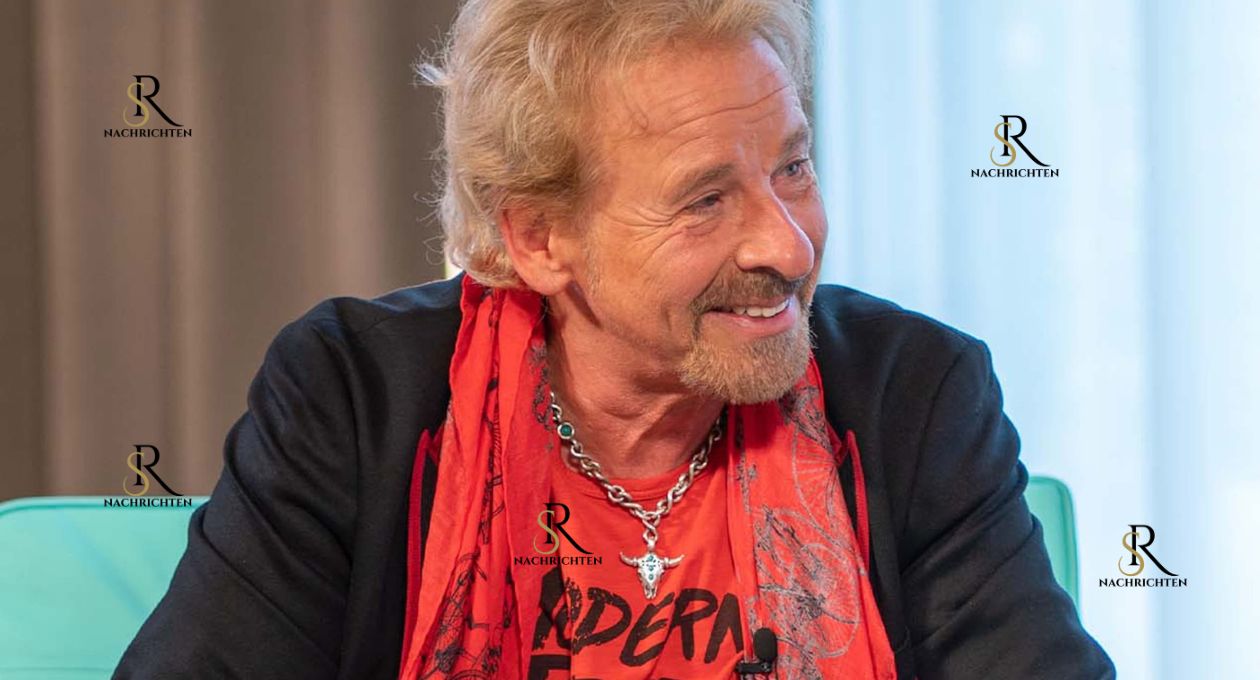Im Sommer 2025 hat die Digitalisierung in Deutschland nicht nur an Bedeutung gewonnen, sondern ist auch rechtlich verbindlicher geworden. Neue EU-Vorschriften wie der AI Act, Data Act und die NIS2-Richtlinie verlangen von Verwaltungen, Unternehmen und Bildungseinrichtungen technische und organisatorische Anpassungen. Was früher Zukunftsmusik war, ist nun gelebter Alltag – mit Chancen, Herausforderungen und ersten Erfolgen auf kommunaler Ebene, wie im Landkreis St. Wendel.
Die Digitalisierung wird durch neue EU-Gesetze greifbar: Der AI Act verpflichtet seit Februar 2025 alle KI-Anbieter zur Klassifizierung, Risikobewertung und Transparenz, besonders bei sogenannten Hochrisiko-Anwendungen wie Kreditvergabe, Gesundheitsvorsorge oder Bildung. Auch kleine Betriebe, die KI nutzen, sind betroffen. Ergänzt wird das durch den Data Act, der ab September 2025 Regeln für Datenzugang, -weitergabe und Interoperabilität festlegt – zum Beispiel bei Smart-Home-Geräten oder digitalen Plattformen. Das Ziel ist, dass von Maschinen erzeugte Daten unter bestimmten Bedingungen auch Dritten zugänglich gemacht werden, was technische und rechtliche Anpassungen für viele Firmen bedeutet.
Die NIS2-Richtlinie, Anfang 2025 in deutsches Recht umgesetzt, betrifft vor allem kleine und mittlere Unternehmen in kritischen Sektoren wie IT, Energie, Logistik und Gesundheit. Diese müssen erstmals umfangreiche Cybersicherheitsmaßnahmen dokumentieren und melden.
Diese Regelungen prägen zunehmend die strategische Ausrichtung der Digitalwirtschaft. Beispielsweise mussten große Gaming-Publisher wie Electronic Arts und Ubisoft ihre Lootbox-Systeme an nationale Vorschriften anpassen, da diese in einigen Ländern als Glücksspiel gelten und verboten sind. Die traditionelle Glücksspielbranche ist dagegen bereits stark reguliert – die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder überwacht hier Anbieter mit deutscher Lizenz, während international lizenzierte Plattformen etwa in Malta oder Curaçao weiterhin stark vertreten sind, was Auswirkungen auf Markt und Infrastruktur hat.
Digitale Regulierung wird so zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor: Wer früh Standards einhält, sichert sich Wettbewerbsvorteile und Vertrauen. Besonders deutlich zeigt sich das in der Industrieautomatisierung, wo Firmen KI-gesteuerte Wartungssysteme und digitale Zwillinge nutzen. Neue Vorschriften verlangen, auch interne Algorithmen zu dokumentieren und bewerten, was für viele Mittelständler die Wahl von Softwareanbietern und IT-Sicherheitssystemen beeinflusst.
Auch auf kommunaler Ebene und in der Bildung ist der Wandel spürbar. So hat der Stadtrat von St. Wendel im Juli 2025 sein Stadtentwicklungskonzept aktualisiert, um Digitalisierung und Daseinsvorsorge stärker zu berücksichtigen – mit digitalen Bürgerdiensten, vereinfachten Bauanträgen und Smart-City-Projekten. Im Bildungsbereich unterstützt etwa die Digital Talent Factory Saar Jugendliche mit kostenfreien Kursen zu Coding, Robotik und KI, um digitale Kompetenzen praxisnah zu fördern.
Gleichzeitig stehen kleinere Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vor komplexen Anforderungen, insbesondere durch die NIS2-Richtlinie, die professionelle IT-Sicherheitsstrukturen fordert. Viele Kommunen und Mittelständler sind ohne fachliche Hilfe und ausreichendes Budget überfordert. Auch die Debatte um digitale Teilhabe gewinnt an Bedeutung, da trotz guter technischer Ausstattung vielen Menschen Orientierung und Zugang fehlen.
Die Digitalisierung 2025 ist somit nicht nur eine Frage von Technik und Innovation, sondern zunehmend von Pflicht, Verantwortung und Standardisierung. Ohne Weiterbildung, klare Rechtslagen und finanzielle Unterstützung droht gerade kleinen Akteuren ein Rückstand. Gleichzeitig bietet die digitale Transformation die Chance auf nachhaltigen Fortschritt, wenn sie umsichtig und gut begleitet umgesetzt wird.